
|
Universalgeschichte Werden keine zeitlichen oder räumlichen Einschränkungen in der Begrenzung dessen vorgenommen, was als Geschichte untersucht wird, spricht man von Universalgeschichte. Ihr zu Grunde liegt in der Regel die Idee, dass alles, was in der menschlichen Welt geschehen ist, geschieht und geschehen wird, in irgendeiner Form miteinander in Zusammenhang steht, und seien diese Verbindungslinien auch noch so dünn. Über Kulturkontakte können wechselseitige Beeinflussungen zwischen Räumen geschehen, über Traditionen oder Überlieferungen Epochen aufeinander einwirken. Eine solche Auffassung von Universalgeschichte sieht das Universale in der Geschichte selbst, ist mithin eine materiale Universalgeschichte. Eine formale Universalgeschichte sucht in den verschiedenen Zeiten und Räumen der Geschichte nach Vergleichbarem, nach Analogien oder nach gemeinsamen Strukturen. Eine direkte Beeinflussung von Kulturen ist nicht ausgeschlossen, ist aber zunächst nicht die methodische Annahme. Vielmehr wird nach formalen Strukturen gesucht, die in unterschiedlichen zeitlichen und räumlichen Formationen gleich oder ähnlich auftreten um daraus Regelmäßigkeiten oder Strukturanalogien in der Geschichte auszumachen. Ein Beispiel für diese Form der Universalgeschichte ist der Marxismus. In ihm wird die Geschichte als Abfolge von Klassenkämpfen interpretiert. In den verschiedenen Epochen stehen sich zwar unterschiedliche Klassen gegenüber, aber die formale Struktur, die letztlich den Fortschritt in der Geschichte bedingt – das kämpferische Aufeinandertreffen einer sozialen Gruppe von Besitzenden und einer größeren von Besitzlosen, ist immer die gleiche. Universalgeschichte betreiben zurzeit nur wenige Historiker und Historikerinnen. Zum einen steht unsere Zeit dem Glauben, das Ganze noch erfassen zu können, skeptisch gegenüber (-> Postmoderne). Zum anderen müsste eine Zusammenfassung Prinzipien angeben können, nach denen diese Synthese funktioniert. Historiker und Historikerinnen, die dem Neo-Historismus zuzurechnen sind, halten ein solches Verfahren für nicht praktikabel, da es dem Individualitätsaxiom widerspricht. Politisch erwünscht sind in jüngster Zeit Gesamtdarstellungen der Europäischen Geschichte. Als Handbücher sind auch Deutsche Geschichten noch von Bedeutung, wobei die Werke von Hans-Ulrich Wehler und Thomas Nipperdey über den puren Handbuchcharakter hinausgehen und Synthesen der Geschichtsschreibung liefern, die den Forschungsansatz fast einer ganzen Generation von Forschern repräsentiert – Wehler vom Standpunkt einer Historischen Sozialwissenschaft aus, Nipperdey von jenem eines anthropologisch modifizierten Historismus. In all diesen Arbeiten ist ein durch eine räumliche und zeitliche Begrenzung umgrenzter Gegenstand Inhalt dessen, was als Universales in den Blick kommt. Eine andere Art der Universalgeschichtsschreibung hat die Annales-Schule in der von ihr so genannten ‚histoire totale’ angestrebt. In einem zeitlich und räumlich eng begrenzten Rahmen wird versucht, die gängige disziplinäre Begrenzung aufzubrechen und nicht mehr eine Politische Geschichte oder Wirtschaftsgeschichte oder Kulturgeschichte zu schreiben, sondern alle diese Faktoren zu synthetisieren. Es wird angenommen, dass sich in der alltäglichen Wirklichkeit diese Faktoren nicht trennen lassen, sondern dass dies nur eine heuristisch sinnvolle, vom Erkenntnissubjekt verursachte Fokussierung des Blicks beschreibt. Auf der kleinen Ebene einer Provinz oder einer Stadt für einen eng umgrenzten Zeitraum wird versucht, die wechselseitige Bedingung und Durchdringung unterschiedlicher Faktoren zu untersuchen. Histoire total in dieser Form ist nicht nur ein Versuch, der Komplexität von Geschichte dadurch gerecht zu werden, dass man alle geschichtsmächtigen Faktoren zu berücksichtigen sucht, es ist auch besonders eine Herausforderung an den Autor bzw. die Autorin, der Ambivalenz und Vielschichtigkeit des Historischen einen strukturierten Text entgegenzusetzen. Aus diesem Ansatz der französischen Annales-Schule entwickelt sich in Deutschland die häufig einem sozialwissenschaftlichen Blick verbundene Mikrogeschichte. Koselleck hat in seiner theoretischen Begründung einer Begriffsgeschichte als neben der Sozialgeschichte wesentlichem Bestandteil einer Allgemeinen Geschichte die Möglichkeit einer histoire totale mit dem Argument negiert, dass die wechselseitige Bedingung des gesellschaftlichen Geschehens und darüber in Begriffen Redens, was selbst wiederum zu gesellschaftlichem Geschehen wird, beständig Differenz erzeugt, die es unmöglich macht, einen Punkt einzunehmen, von dem aus das Ganze zu überblicken sei. Geschichtswissenschaft vollziehe sich daher immer im „Vorgriff auf Unvollkommenheit“. Stefan Haas Literatur Koselleck Zitat aus: Reinhart Koselleck: Sozialgeschichte und Begriffsgeschichte. in: Wolfgang Schieder/Volker Sellin (Hg.), Sozialgeschichte in Deutschland. Entwicklungen und Perspektiven im internationalen Zusammenhang, Bd. 1: Die Sozialgeschichte innerhalb der Geschichtswissenschaft, Göttingen 1986, S. 89-109, Zitat von S. 93. |
|||
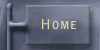 |
||
 |
||
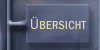 |
||
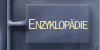 |
||
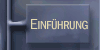 |
||
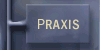 |
||
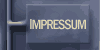 |
||
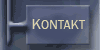 |
||
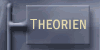 |
||
 |
||
 |
||
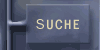 |
||
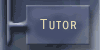 |
||