
|
Gruppe mit gemeinsamen Erkenntnisinteresse – Erkenntnistheoretischer Kollektivismus Soziale Gruppen für Erkenntnis verantwortlich zu machen, ist eher eine Angelegenheit sozialkritischer Wissenschaftstheorie. Wer sich um einen positiv-produktiven Aufbau von Wissenschaftlichkeit bemüht, versucht meistens einen Weg zu finden, der einen Argumentationsweg zu erstellen erlaubt, der alle Menschen integriert. Kritiker versuchen dann dagegen zu argumentieren, indem sie herausarbeiten, dass der angestrebte Universalismus doch nur den Machtanspruch einer relativ kleinen Gruppe kaschiert. Hochphase dieses Ansatzes, den man als Ideologiekritik bezeichnen kann, sind die 1960er und 70er Jahre. Vornehmlich linke Wissenschaftstheoretiker thematisierten gruppenspezifische Erkenntnisinteressen und kritisierten diese. Auch ein großer Teil des frühen feministischen Diskurses gehört in diese Richtung, insofern sie das Erkenntnissubjekt als männlich entlarvten und auf eine Erweiterung des Begriffes drängten. Ab und zu werden diese Ansätze auch nicht kritisch, sondern positiv gewendet. Sehen wir mal von dem Unsinn ab, dass nur „gereifte“ oder „erfahrene“ Wissenschaftler Erkenntnis formulieren können, was in der Alltagspraxis zwar häufig vorkommt, sich aber erkenntnistheoretisch überhaupt nicht legitimieren lässt, dann funktionieren solche Ansätze in der Regel über die Legitimierung einer Gruppe als „Minderheit“. So wird im feministischen Diskurs teilweise das Frausein als Voraussetzung zur Erkenntnis spezifischer Sachverhalte formuliert oder ethnische Minderheiten formulieren im interkulturellen Diskurs solche Ansprüche gegenüber dem hegemonialen Diskurs des abendländischen Rationalismus. Ins Esoterische oder semireligiöse gleitet dieser Typ Erkenntnistheorie, der hier als erkenntnistheoretischer Kollektivismus bezeichnet wird, ab, wenn er eine spezifische Erleuchtung als Voraussetzung für das Erkennen formuliert und Erkenntnis nur jenen Gruppen vorbehält, die im Besitz dieser Erleuchtung sind. TEXTVARIANTE: Diese Auffassung hat ihre ausführliche Formulierung in den Arbeiten von Jürgen Habermas und Karl-Otto Apel gefunden. In ihren wissenschaftskritischen Arbeiten gehen sie davon aus, dass jeder erkennenden Tätigkeit eine bestimmte Absicht unterliegt, die sie mit dem Begriff des Erkenntnisinteresses umschreiben. Dieser Begriff hat etwas kritisches, beinhaltet aber auch die Einsicht, dass man ein persönliches Moment im Erkenntnisprozess nicht umgehen kann. Man hat immer ein Interesse an einem bestimmten Ergebnis. Dieses Interesse resultiert aus der jeweils spezifischen Lebenssituation. Da die Arbeiten der beiden Philosophen in den späten 60er Jahren entstanden, denken sie diese Lebenssituation sozialwissenschaftlich und kommen zu einem Gruppen- bzw Gesellschaftsbegriff, der das jeweilige Erkenntnisinteresse prägt. Der einzelne ist Teil einer Gemeinschaft, die einen bestimmten Zweck verfolgt: beispielsweise die Durchsetzung eigener Machtansprüche oder die Verteidigung der Errungenschaften der Aufklärung wie Demokratie und individuelle Selbstbestimmung. Für den Wissenschaftler bedeutet diese Auffassung, dass er sein Erkenntnisinteresse offen legen, dass er es nicht hinter dem Deckmantel scheinbarer Objektivität verbergen soll, sondern dem Leser selbst die Möglichkeit geben muß, den Standort seiner Aussagen einschätzen zu können. Aussagen gelten dann immer nur vor dem jeweiligen Hintergrund eines Erkenntnisinteresses. Diese Thesen haben wesentlich dazu beigetragen, dass heute in Einleitungen guter historischer Arbeiten eine Selbstreflexion des eigenen Vorgehens stattfindet und nicht mehr naiv von einer Selbstverständlichkeit des Gesagten ausgegangen wird. Die Bielefelder Schule um Wehler und Kocka hat sich stark auf Habermas berufen und ihr Wissenschaftsverständnis hieran ausgebildet. Der Nachteil dieser wissenschaftssoziologischen Position ist, dass immer noch nicht angegeben werden kann, wie eine wissenschaftliche Arbeit verfasst werden sollte. Daneben merkt man dieser Theorie den soziologistischen Ansatz der 68er Generation an, der heute in die Jahre gekommen ist. Zu fragen ist, ob dieser Ansatz nicht durch ein formal erkenntnistheoretisches Argument ergänzt werden muss. Stefan Haas |
|||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
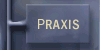 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
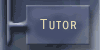 |
||