
|
Wissenschaft produziert unser Bild der Welt Trotz aller Tendenzen zu Esoterik und neuen Formen der Spiritualität zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist die Welt, in der die Menschen zumindest in den Industrie- und Postindustrieländern leben, von wissenschaftlichem Denken und deren Ergebnissen bestimmt. Zentrale Fragen, beispielsweise jene der Abstammung des Menschen, werden von den Wissenschaften beantwortet. Soziale Handlungen werden von den Wissenschaften bestimmt, beispielsweise bei der Heilung von Krankheiten. Wissenschaftliches Denken dominiert die Lehrpläne der Schulen. Wo Fragen wissenschaftlich sich nicht eindeutig klären lassen, beispielsweise jene nach dem Sinn des Lebens, werden diese häufig im Namen der Wissenschaften für unwissenschaftlich und damit unsinnig erklärt. Die Wissenschaften produzieren damit die grundlegenden Annahmen, die angeben, wie wir Welt erleben und uns in ihr einrichten. Die radikale Form, die die angesprochenen, nicht eindeutig zu beantwortenden Fragen als unwissenschaftlich klassifiziert, kann als Positivismus bezeichnet werden. In Anklängen findet man diesen bereits in der Aufklärung, das erste ausführlich ausgearbeitete System formulierte der französische Philosoph Auguste Comte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der damit auch zu den Begründern der Soziologie zählt. Der Positivismus ist eine Wissenschaft, die sich nur an das Gegebene (das Positive) hält. Positiv hat damit weniger die Konnotation von richtig, korrekt oder schön, sondern von gegeben, empirisch erfahrbar, evident. In Comtes wissenschaftlich geprägter Philosophie nehmen geschichtsphilosophische Argumente einen entscheidenden Platz ein: Dem theologisch geprägte Zeitalter, in dem Welt und Denken nach religiösen Motiven geordnet werden, folgt eine Zeit der Metaphysik, in der spekulative Systeme das Theoretisieren beherrschen. Auf der Grundlage eines Arguments, wie beispielsweise Cogito ergo sum, werden in sich schlüssige, aber nicht empirisch beweisbare Weltentwürfe entwickelt. Descartes, Hobbes, Kant, Hegel sind einige Namen, die Comte hier nennen würde. Erst das dritte Zeitalter erreicht vernünftige Klarheit und rationale Einsicht, es ist das wissenschaftliche, dessen Wissen auf naturwissenschaftlich empirischer Basis sich bewegt und nur jene Antworten zulässt, die dem hohen Standard an Nachweisbarkeit entsprechen. Alle Positionen, die Erkenntnis als Teilarbeit zum Ganzen des wissenschaftlichen Weltbildes begreifen, ähneln im Kern dieser Comteschen Position, auch wenn sie deren Überzeugungen und Annahmen im Detail nicht teilen. Für die Geschichtswissenschaft bedeutet dies, dass sie nach einem langen Durchsetzungsprozess im 19. Jahrhundert das Geschichtsbild produziert, das in westlichen Gesellschaften als gültig anerkannt wird. Sie bestimmt mit ihren Ergebnissen die Lehrpläne für Schulen. Das war nicht immer so. Lange Zeit war das Geschichtsbild von Glauben oder pragmatischen Ansätzen dominiert. Im Kern beantwortet die Geschichtswissenschaft zwei Fragen, die für das Weltbild der aktuellen Gesellschaft von hoher Bedeutung sind: (1) woher kommen wir bzw. wie ist die Welt entstanden, in der wir heute leben, und (2) welche Alternativen gab es, was hätte anders verlaufen können, welche Entwicklungen wurden abgebrochen, was war anders an vergangenen Epochen, als es heute ist. Diese beiden Antworten lassen sich auf zwei Grundprinzipien des wissenschaftlichen Denkens beziehen: dasjenige der Identität, das eine Verbindbarkeit von zwei Punkten, in diesem Fall der Vergangenheit und der Gegenwart annimmt (um zwei Punkte verbinden zu können, müssen diese bei aller Verschiedenheit in einem Punkt identisch sein, damit überhaupt ein Bezug hergestellt werden kann), und dasjenige der Differenz, das von einem grundlegenden Unterschied ausgeht, in diesem Fall, dass sich die gegenwärtige oder eine frühere Epoche nicht aus der davor liegenden entwickelte, sondern durch einen fundamentalen Bruch entstanden ist. Diese Unterscheidung von identitäts- und differenztheoretischem Ansatz prägt derzeit die Diskussionen der Geschichtswissenschaft entscheidend. Unabhängig davon resultiert für den einzelnen Historiker und die einzelne Historikerin aus der hohen Bedeutung der Forschungen der Geschichtswissenschaft für die Gesellschaft und Kultur die Notwendigkeit eines hohen Maßes methodischer und selbstkritischer Reflexion der eigenen Tätigkeit. Stefan Haas
|
|||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
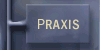 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
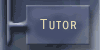 |
||