
|
Debatten um die Postmoderne in der Geschichtswissenschaft Es bedarf keiner Lektüre theoretischer Texte, um sich mit postmodernen Sachverhalten auseinanderzusetzen. Nur ein offenes Auge für die Antinomien der bisherigen Forschungsstrategien und für die soziokulturellen Entwicklungen der letzten Jahre. Wenn ein Bankangestellter, der während der Arbeitszeit einen konservativen Anzug trägt, sich am Wochenende in einen hypersportiven Extremisten verwandelt und abends sich in New Gothic-Outfit hüllt, dann vollzieht er jene Wandelbarkeit von Selbstbildern, von denen die Postmoderne abstrakt spricht. Identität wird zum Kleidungsstück, das ich beliebig variieren kann. Ähnlich kann ich in einem Text eine systemtheoretische Fundierung verwenden und in einem nächsten eine dekonstruktive und gehe dergestalt als einheitsstiftender Autor verloren. Nur unverbesserliche Modernisten, die am Wahrheitsanspruch festhalten um ihre eigene Person in den Mittelpunkt zu schieben, erzählen ihre Identität noch stolz als jahrzehntelanges Festhalten an denselben Positionen: „Das habe man ja bereits 1962 gesagt“. Dennoch hat die Geschichtswissenschaft lange gebraucht, um sich auf die Ambivalenz, Heterogenität und Pluralität unserer Lebenswelt und unserer wissenschaftstheoretischen Überzeugungen einzulassen. Stärker als die meisten anderen Wissenschaften hält sie am Wahrheitsanspruch, an Objektivität und Theoriefeindlichkeit fest und reproduziert zum je eigenen Machterhalt ständig die optimistische Position des Historismus. Entsprechend ihrer Zurückhaltung sind die ersten Debatten, die sich mit postmodernen Themen auseinandersetzen, Rückzuggefechte. Lawrence Stone hielt gegen die postmodernen „Bedrohungen“ die narrativen Elemente des ‘Geschichten erzählens’ hoch und wandte sich damit gegen Theorieorientierung und gegen die Ausweitung des Blicks auf alternative Darstellungsformen und analytische Methoden. Denn woher sollen neue Ergebnisse kommen, wenn nicht aus einer bewussten Verlagerung des eigenen Blicks, den aber derjenige, der sich die Quellen anschaut und diese nur nacherzählen will, nicht zu erreichen vermag, spricht er doch immer nur von dem, was er schon immer in sich hatte. Radikaler war die Annales. 1989 verabschiedete sie sich von marxistischen und strukturalistischen Begründungen, von den Hoffnungen, die sich seit Braudel und Labrousse mit den quantitativen Methoden verbanden, und damit von den Metaerzählungen der späten Moderne. Auch italienische, britische und amerikanische Sozialhistoriker begannen durch eine stärkere Rezeption von Ethnologie und Sprachwissenschaft den ‘harten Stil’ der klassischen Sozialgeschichte aufzuweichen. Motiv war dabei immer der erkenntnistheoretische Zweifel an der Triftigkeit der traditionellen Methoden und Theorien. Am weitesten war man wohl in Amerika in der Rezeption des lingustic turn gegangen, wo die realitätsschaffende Kraft der Sprache breit diskutiert wurde. Aber der linguistic turn ist weit älter als die Postmoderne. In Deutschland am ehesten spürbar sind die Veränderungen in der Themenwahl. Es werden solche Gegenstände untersucht, die als wirklichkeitsbildend angesehen werden: Sprache, Kultur, Symbole, Erinnerung, Körper und Geschlecht. Sie haben die noch vor einigen Jahren virulenten Themen wie sozialer Konflikt, Macht und Herrschaft abgelöst. Stefan Haas Literatur Christoph Conrad/Martina Kessel (Hg.), Geschichte schreiben in der Postmoderne. Beiträge zur aktuellen Diskussion, Reclam: Stuttgart 1994. Äußerst brauchbarer Reader mit zentralen Texten sowie einer sehr guten Einleitung, die einen Überblick über den postmodernen Diskurs in der Geschichtswissenschaft bietet. |
|||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
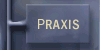 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
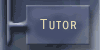 |
||