
|
New Historicism (New Cultural History / Cultural Poetry) New Historicism ist ein in den 1980er Jahren mit dem Schwerpunkt ‘Renaissanceforschung’ eingeführter Begriff, der wesentlich durch die Arbeiten des in Berkeley lehrenden Stephen Greenblatt geprägt wurde. Weitere namhafte Vertreter dieser Richtung sind S. Bercovitch, J. Dollimore, C. Gallagher, F. Lentricchia, Louis Montrose und H.A. Veeser. Zunächst in einer Einleitung als Stichwort für eine Aufsatzsammlung zum Thema Macht und Renaissance (1982) verwendet, hat der Ausdruck zu Greenblatts eigenem Erstaunen weitreichende Popularität erfahren. Um seinem inflationären Gebrauch und seiner naheliegende Verwechslung mit der deutschen Schule des »Historismus« vorzubeugen, werden von Greenblatt mittlerweile die Ausdrücke »Cultural History« oder »Cultural Poetry« bevorzugt. Weniger ein in sich geschlossenes Theoriekonzept denn eine „Arbeitsweise“ (1986, S. 258), verbindet der Ansatz die Analyse poetischer bis philosophisch-wissenschaftlicher Literatur und Kunst mit einer am Marxismus und Feminismus geschulten Gesellschaftskritik, wobei sich die Darstellung maßgeblich an der Ethnographie Clifford Geertz’ und der Diskursanalyse Foucaults orientiert. Als Gegenbegriff zum »New Criticism« gewählt, der das literarische Kunstwerk als in sich geschlossene Einheit begreift und sich unter Verzicht auf historisch-biographische Hintergründe allein auf die Arbeit am vorliegenden Text konzentriert, geht Greenblatt von der vielschichtigen Verzahnung von Kultur, Gesellschaft und ihren jeweiligen Ausdrucksformen und Darstellungen aus. Dies bedeutet allerdings nicht, dass ein Text oder Gegenstand auf der einen Seite einem Geschichts- oder Gesellschaftskontext auf der andere Seite gegenüberzustellen wäre. Statt dessen wird der Kontext der Geschichte im Sinne eines objektiven Hintergrundes selbst radikal in Frage gestellt und wie Literatur und Kunst als Konstrukt einer Darstellung begriffen, in dem hier wie dort ein jeweils zeitspezifisches „Netzwerk von Institutionen, Praktiken und Anschauungen, die die Kultur als ganze konstituieren“ (1982, S. 29) wirksam ist. Angenommen wird ein wechselseitiges Durchdringungsverhältnisses in bezug auf die „Geschichtlichkeit von Texten und der Textualität von Geschichte“ (Montrose, 1989). Damit erweitert sich das Quellenmaterial um ein Vielfaches und jeder Text oder Gegenstand löst sich in ein komplexes Bündel kulturell zu verortender Aussageformen und Handlungsweisen auf. Greenblatt selbst tendiert dabei zum Anekdotischen, obwohl er gleichzeitig die Fähigkeit zur Übersicht über den epochenspezifischen Gesamtzusammenhang voraussetzt. Thorsten Feldbusch |
|||
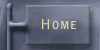 |
||
 |
||
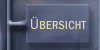 |
||
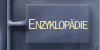 |
||
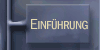 |
||
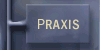 |
||
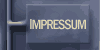 |
||
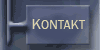 |
||
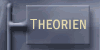 |
||
 |
||
 |
||
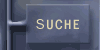 |
||
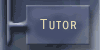 |
||