
|
Stephen Greenblatt und der New Historicism Einer der Mitbegründer des New Historicism, einer in den vergangenen zwei Jahrzehnten einflussreichen Forschungsrichtung der Literaturtheorie und Literaturkritik, ist der amerikanische Anglist und Literaturtheoretiker Stephen Greenblatt. Er wurde 1943 geboren, studierte in Yale, wo er 1969 den Doktortitel erwarb, und lehrt seitdem in Berkeley. Seine Arbeiten haben ihre Schwerpunkte in der Literaturtheorie und in der Renaissanceforschung. In Renaissance Self-Fashioning (1980) untersucht Greenblatt, wie sich zentrale Konzepte der Frühneuzeitforschung – Individualität und Identität – mit poststrukturalistischen Mitteln neu definieren lassen. Beeinflusst von Dekonstruktion und Diskursanalyse, versucht er zu zeigen, wie die Idee des „Selbst“ nicht nur (fiktionale und nicht-fiktionale) Texte generiert, sondern ihrerseits ein Effekt textueller Konstrukte ist. Der ahistorische Zug der dekonstruktiven Subjektkritik wird bei Greenblatt durch die genaue historische Verortung der identitätserzeugenden Diskurse aufgefangen. In Shakespearean Negotiations (1988) erprobt Greenblatt neue Kontextualisierungen von Hauptwerken Shakespeares, deren historischer Hintergrund aus positivistischer Sicht schon als weitgehend erforscht galt. Die Metapher des Text-Hintergrunds wird von Greenblatt konsequent abgelehnt: Der kanonisierte Text, nur ‚am Rande’ überlieferte Anekdoten und historische Ereignisse in ihrer inhärenten Symbolhaftigkeit (für die Zeitgenossen, nicht unbedingt für die Nachwelt) stehen auf derselben Stufe. „Soziale Energie“ zirkuliert von der Hochliteratur bis in die nur spärlich überlieferten Details des Alltagslebens – und in umgekehrter Richtung. An Foucault anschließend, stellt Greenblatt auch die Frage nach dem Zusammenhang von Macht und Subversion. Er beantwortet sie mit dem umstrittenen Konzept des containment: Subversion sei im England der Renaissance mitunter nichts weiter als ein entschärfender Effekt der Macht selbst. In Marvelous Possessions (1991) kehrt er zur Frage der Identität zurück. Diesmal geht es ihm jedoch primär nicht um individuelle, sondern um kulturelle Identität, wobei er beide aber konzeptionell vollständig voneinander löst. Die europäischen Eroberer ‚exportieren’ ihr Selbstverständnis nicht einfach in das kolonisierte Amerika: Die Erfahrung der Alterität hat entscheidenden Anteil an der Definition der eigenen Identität und wird in Offenheit und Abwehr zum Katalysator des politisch-kulturellen Selbstbilds. Jörg Löffler |
|||
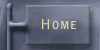 |
||
 |
||
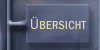 |
||
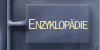 |
||
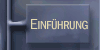 |
||
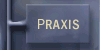 |
||
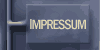 |
||
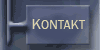 |
||
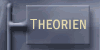 |
||
 |
||
 |
||
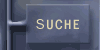 |
||
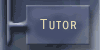 |
||